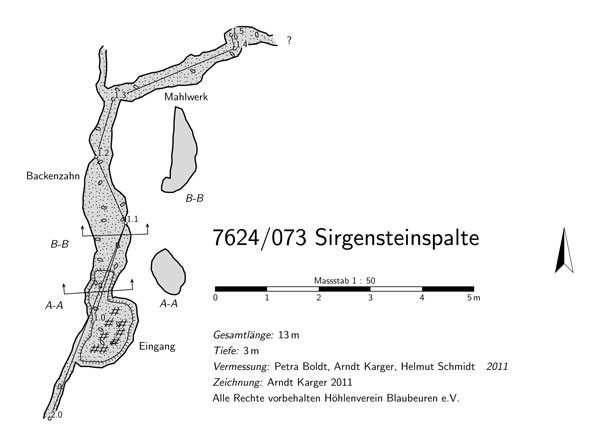Es zeichnete sich ab, dass das Gestein (Dolomitkalk) in der Sirgenstein-Spalte nur kleine Forschungsfortschritte zulässt. Nachdem sich der weitere Gangverlauf in östliche Richtung ausrichtet und derzeit nur jugendliche Höhlenforscher bis zum Höhlenende gelangen können, rückte eine östlich der Sirgenstein-Spalte gelegene Doline vermehrt in den Fokus der Forschung. Unbürokratisch wurde vom zuständigen Revierleiter die Erlaubnis erteilt, die mit Altholz und Unrat verfüllte Doline zu säubern.

"Urzustand" der Sirgensteindoline / die Höhlen-AG bzw. die Jugendmitglieder des HvB bei der Putzete
Ende April 2011 konnten durch Windmessungen mittels eines Anemometers Zusammenhänge zwischen der Doline und der Sirgenstein-Spalte nachgewiesen werden.
Aufgrund dieser Erkenntnisse kamen die Vertreter der Museumsgesellschaft Schelklingen und des Höhlenvereins Blaubeuren überein, hierfür eine offizielle Grabungsgenehmigung zu beantragen.
Im September 2011 wurde die amtliche Genehmigung erteilt; Forschung und Arbeiten werden nunmehr als "Projekt Sirgenstein" geführt.
Unmittelbar danach konnten erste Sondierungsgrabungen durch Mitglieder beider Vereine sowie der Höhlen-AG des Gymnasiums in Blaubeuren vorgenommen werden. In dabei angeschnittenen Spaltenöffnungen konnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 0,21m/sec gemessen werden.

Erste "Sondierungskanal"-Grabung

Grabung am 03. März 2012 - Der Winter und das Schmelzwasser haben doch eine Menge Humus eingespült.
 |
In der folgenden Zeit wurden die Sondierungsgrabungen erweitert, bis an zwei Seiten der Doline anstehender Fels zu sehen war. Da die Seite der Doline, welche dem Hang am nächsten liegt, langsam zu rutschen begann, haben wir diese im Herbst 2012 durch einen Verbau aus Leitplanken gestützt.
Und schließlich kam auch wieder der Winter, in dem es mit Grabungsterminen nichts wurde.
|
Erster Verbau. Bild: Arndt Karger 2013
2013:
Es bleibt aber nicht für immer Winter, denn es ist wie es in einem Volkslied heißt: „Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.“ Die Zeit bis dahin verging wie im Flug, und im neuen Frühling hatten wir bald auch schon einen Leitspruch gefunden: „das muss tiefer!“. (Weitere Tieferlegungsarbeiten) Sehr interessant waren die kleinen Löcher und Luftblasen, welche wir immer öfter im Sediment fanden.
Durch die immer größer werdende Tiefe der Doline so wuchs nun auch die Gefahr, dass eine der drei weiteren Seiten der Doline abrutschten könnten. Aus diesem Grund wurde an einem Wochenende im Sommer 2013 auch der Rest der Doline verbaut.
An diesem Wochenende war es sehr warm, sodass uns bei der Arbeit in der immerfeuchten Doline so manche Mücke um die Ohren surrte. Zuerst bauten wir (Robert und Werner Eckart sowie ich, Arndt Karger) einen Kasten aus Winkeleisen, in welchen wir anschließend Leitplanken einpassten.

Robert Eckart beim Schraubenlöcher bohren. Bild: Arndt Karger 2013
 |
Nun war die Doline wieder soweit sicher, dass wieder gegraben werden konnte. Immer häufiger waren nun Steinblöcke im Sediment zu finden, welche wir teils zertrümmern konnten, teils aber auch nur auszugraben hatten, um sie an die Oberfläche zu befördern. |
Sirgensteindoline mit zweitem Verbau. Bild: Arndt Karger 2013
Bei der letzten Grabung im Jahr 2013 wurde klar, in welcher Richtung sich die Doline wohl im Untergrund fortsetzten würde. Dies war daraus ersichtlich, dass sich der Boden in Richtung der Hochfläche immer mehr in eine Rinne verwandelte. Diese Rinne hatte zuletzt nur noch eine Breite von ca.10 cm.

Blick unter den ersten Verbau.
Der einzige Schluss, der daraus zu ziehen war ist, dass die Hauptrichtung wohl näher am Hang in den Untergrund führen würde. Sprich, genau dort, wo ein Jahr zuvor ein Verbau gesetzt wurde. Also blieb uns nichts anderes übrig, als den Aushub, welchen wir hinter den Verbau geworfen hatten, wieder abzugraben.
Da aber langsam der Winter einbrach, wurde das erneute Ausheben und Umlagern auf das nächste Jahr vertagt.
2014:
Nach einem sehr milden Winter begannen wir nach ein paar Einzelterminen auch gleich mit einer etwas größeren Aktion. Und zwar veranstaltete ich einen Grabungsmarathon um Ostern, an welchen die Kinder der Höhlen AG ein beinah ferienfüllendes Höhlengrabungsprogramm geboten bekamen. Im Zuge dieser Aktion wurde das Sediment hinter dem 1. Verbau vollständig ausgehoben, und der Verbau demontiert. Nun musste nur noch ein neuer Verbau her! Dieser war auch bald gesetzt und somit konnte weiter gegraben werden.
 |
Und wie es der Zufall will, finden wir bei der nächsten Grabungstour einen kleinen Schacht. Dieser führt ca. 2m in die Tiefe und ist mit Steinblöcken angefüllt. An den Wänden sind deutliche Korrosionsspuren zu sehen, welche auf stehendes Wasser hindeuten. Dadurch sind viele kleine Grate entstanden, welche aus der Wand herausstehen, daher auch der Name: „Messerschacht“.
Eigentlich hätte man über den Sommer einiges graben können, aber die einen waren dann hier unterwegs, andere da und manche hatten einfach keine Lust sich auf die Alb zu quälen! |
Höhlen AG Teilnehmer beim graben hinter dem ersten Verbau.
Bild: Franz Baumann 2014

Blick in den Messerschacht. Bild: Arndt Karger 2014
Also wurde nichts aus der Grabungszeit im Sommer, blieb nur noch der Herbst. Doch „erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!“.
 |
Eines Abends im Spätsommer transportierten Marc Krömer und ich noch etwas Material zur Grabungsstelle, als wir das Malheur sahen. Den Neuen Verbau hatten wir auf eine Felsnase gesetzt, welche ihn tragen sollte. Doch genau da lag das Problem! Diese „Felsnase“ war eben kein Felsnase, sondern ein großer Block, welcher wohl bei einem stärkeren Regenguss abgerutscht war. Da hing er nun, der Verbau!
Was blieb uns anderes übrig, als bei den nächsten Touren den Verbau wieder zu demontieren und einen neuen zu setzten.
|
vlnr. Arndt Karger, Sebastian Heiland bei der Beförderung einiger Steine aus dem Messerschacht.
Nun kam aber wieder das altbekannte Problem auf, dass keine Leute zu finden waren. Somit zog sich diese Arbeit bis in den Winter hinein.
Helmut Schmidt (bis März 2012)
Arndt Karger (ab April 2012)
Stand: Dezember 2014
nach oben